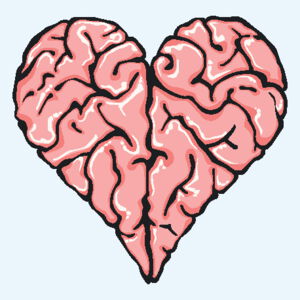
Die Anthropologin, deren Fachgebiet die romantische Liebe wissenschaftlich erforscht, kennt sämtliche psychologische Studien der letzten 45 Jahre zum Thema Liebe. Berühmt wurden Ihre MRT-Messreihen, bei denen sie die Liebe im menschlichen Gehirn visuell darstellen konnte. In diesem Beitrag beantwortet Fisher die Frage, was sich emotional in uns abspielt, wenn wir uns verlieben. Nach Fisher haben sich unsere Vorfahren wahrscheinlich schon vor tausenden von Jahren gefragt, was die Liebe mit den Gefühlen anstellt. Was bewirken die ganzen physischen Veränderungen in unserer Seele? Dazu hat die Liebesforscherin in einer weiterführenden Studie 32 verliebte Personen unter dem MRT-Scan beobachtet. Darunter 17 verliebte Personen in einer glücklichen Beziehung und 15 Verliebte, die kürzlich einen Korb von der/dem Angebeteten bekommen hatten und deren Gefühle nicht erwidert wurden.
Verliebte beginnen damit einer Person spezielle Bedeutung zuzuschreiben.

George Bernard nannte es: „Den Unterschied von einer Frau zu allen anderen Frauen maßlos [zu] übertreiben.“ Niklas Luhmann und andere stimmten ihm zu. Durch die beim verlieben auftretende Bedeutungsüberschätzung kann es passieren, dass schwer Verliebte bis zu 80% ihrer wachen Zeit nur noch an diesen einen besonderen Menschen denken können. Wir beginnen uns auf diesen einen besonderen Menschen gedanklich zu fokussieren. Es kommt dabei zu intensiven Energieerlebnissen im Körper. Dadurch wirken wir auf unser Umfeld in dieser Zeit manchmal etwas unbeholfen. Da wir im gemeinsamen Dialog mit dem besonderen Menschen, also von Date zu Date mehr erfahren, dass uns potenziell triggern kann, reißt dieses Empfinden auch nicht so schnell ab. Emotional kommt es dabei zu einem Annäherungseffekt; wir adaptieren die Vorlieben unseres Gegenübers. Was der geliebte Mensch mag, wird meist ungefragt übernommen – was ihm/ihr missfällt, setzen auch wir wiederum auch auf unsere Hassliste, ohne es vorher normativ zu reflektieren. Mit der Zeit legt sich dies natürlich wieder, aber manche Normen, Werte oder Überzeugungen können tatsächlich dauerhaft ein ganzes Leben lang bestehen bleiben. Gerade, wenn der neue Partner in uns Fähigkeiten entdeckt, von denen wir bislang nicht einmal etwas wussten oder wir unserer großen Liebe unser Hobby zeigen und erleben wie er/sie voll und ganz darin aufzugehen scheint. Solche Momente sind großartig und wirken nicht ohne Grund sehr verbindend.
Im selben Zuge erleben viele Verliebte eine Überemotionalisierung ihres eigenen Realitätsempfindens – gerade wenn der Partner nicht da ist. Wenn etwas gut läuft, bekommt das Gehirn einen positiven Dopaminschub. Wenn etwas nicht gleich gelingt, kann uns das bis an den Rand der Verzweiflung treiben. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt liegen in dieser Phase der Emotionskirmes eng beieinander. Hinzu tritt, dass wir uns durch die Fokussierung auf diese Person unsere gesamte Umweltsicht verändern. Wir bauen emotionale Distanz zu anderen potenziellen Partnern auf, um uns auf diese eine Liebe einzulassen. Neben zentralem Fokus beginnt dann auch unsere Motivation auf diese eine Person ausgerichtet zu funktionieren. Wir wollen diesen Menschen nur für uns haben. Dass Menschen zunehmend sexuell besitzergreifend werden, sobald sie sich verlieben, hat laut Fisher eine darwinistische Begründung. Damit Kinder aus einer Beziehung hervorgehen, müssen die Partner eng miteinander verbunden sein und bei uns Menschen, als klassische K-Strategen, auch bleiben. Survival of the fittest – das Überleben des am besten angepassten Individuums – bevorzugte jene unserer Vorfahren, die sich gemeinsam auf den Aufzug der Jungen konzentrierten. Dadurch wurden ihre Gene häufiger vererbt und das Konzept setzte sich als überlebenssicher durch. Die Idee der kulturellen Treue ist ein Konstrukt, welches wir im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext dazu entwickelt haben. Angefangen bei Thronfolgeregelungen & Co. bis hin zu postmodernen Scheidungsverträgen mit Sorgerechtsstreitigkeiten. Wie genau solche Modelle gesellschaftlich manifestiert werden, liegt an der jeweiligen Kultur, die sie als Problem (oder zumindest als organisationsbedürftiges System) definiert. Die belgische Psychologin und Paartherapeutin Esther Perell hat in diesem Zusammenhang einen hervorragenden Ansatz zur Idee der Monogamie entwickelt. Anthropologisch betrachtet soll Treue jedoch nur die Wahrscheinlichkeit auf das Überleben der Nachkommen, angesichts einer lebensfeindlichen Umwelt, sichern – Mutter Natur bezieht sich hier also eher auf biologische Logik, als auf romantische Liebe. Umso schöner, dass wir letzteres daraus gemacht haben, wenn Sie mich fragen.
Die Gehirnareale, die während Fishers MRT-Tests besonders aktiv wurden, waren dieselben, die auch während eines Kokainrausches getriggert werden. Das Dopamin der Liebe hinterlässt ähnliche Wirkungen auf unsere Nerven-Rezeptoren im Gehirn wie Rauschgift. Das Thema haben wir zwar bereits schon angerissen, jedoch lohnt es sich hier genauer nachzulesen. In den 1970er Jahren wurde in US-Testreihen Kokain an Ratten verfüttert. Schnell merkten die Forscher, dass die Nagetiere zügig süchtig wurden und irgendwann alles andere in ihrer Umgebung für die Droge vernachlässigten (Futter, Schlaf, etc.). Unter Anderem wiesen diese Studien die extreme Suchtgefahr der Droge nach und legitimierten damit die Umsetzung gesetzlicher Verbote. Vielleicht liegt in der erhöhten Sauerstoffversorgung der Dopaminrezeptoren im Gehirn verliebter Menschen der Grund für die Motivation und Fokussierung auf den Liebespartner. Fisher konnte belegen, dass sich die Gehirnaktivitäten von Liebe und einer „Line“ nicht wirklich unterscheiden. Ehemalige Süchtige beschreiben oft, dass sie sich im Rausch stundenlang mit irgendwelchem Blödsinn beschäftigen konnten, ohne, dass ihnen dabei langweilig geworden wäre. Leider haben wir zu diesem Frageaspekt keinerlei wissenschaftliche Forschungsergebnisse oder Statistiken finden können. Vermutlich liegt dieses Forschungsdesign noch brach.
Die Liebesforscherin weist in diesem Zusammenhang auf einen wichtigen Punkt hin. Wie wir bereits festgestellt haben, ist Dopamin mit romantischer Liebe zu verbinden. Es wird ausgeschüttet, sobald wir uns in jemanden verguckt haben. Das Problem, so Fisher, sei mittlerweile keinesfalls mehr das natürliche Dopamin, sondern vielmehr das Serotonin, welches sich in unserer Gesellschaft zunehmender Beliebtheit erfreue. Helen Fischer erkennt im zunehmenden Verschreibungstrend von Antidepressiva eine gefährliche Trendentwicklung. Sie widerspricht kategorisch der Phrase: Geht´s dir nicht gut… schluck eine Pille! Immer wenn wir mit Hilfe der Pharmaindustrie künstlich an den körpereigenen Serotoninwerten herumspielen, wird dieses die Rezeptoren um ein vielfaches eher beanspruchen, als Dopamin dies jemals könnte. Wir verlieren das Interesse an Dopamin. Zudem werden dabei jedes Mal das Serotoninlevel und korrespondierende Toleranzen im menschlichen Körper leicht angehoben.
Alles im Gehirn ist vernetzt und bedingt sich gegenseitig. Wer die Stellschrauben an einem Komplex verstellt, kann allenfalls erahnen was damit an anderen Stellen ausgelöst werden kann. Wer also mit künstlicher Zufuhr von Serotonin die Lust am natürlichen Dopamin durch Liebe und Sex vernachlässigt, vernachlässigt auch den beim Orgasmus ausgestoßenen positiven Gefühlscocktail. Ein Mix, den das Serotonin wiederum nicht liefern kann. Die Langzeitfolgen daraus sind weitestgehend unerforscht. Aber nicht wenige Experten aus Pharmazie und Psychiatrischer Medikation vermuten hier die große, innere Leere, die in unserer postmodernen Gesellschaft immer mehr Depressionspatienten beschreiben.
Vielleicht sollten wir einfach dem Weg folgen, den die Natur für uns vorgesehen hat und manche Möglichkeiten einer zunehmend entgrenzten Welt ignorieren.
Was ist jedoch wichtig dafür, dass wir uns verlieben? Nach Helen Fisher existiert eine Art Love-Map, welche sich jedoch auf mehr Horizonte erstreckt, als herkömmliche Landkarten. Nicht nur räumliche, sondern gesellschaftliche und vor allem die Zeit sind Fishers ausschlaggebende Faktoren. Der Anthropologin zufolge ist es sehr wichtig, wann wir wen treffen, wann wir die passende Gefühlslage haben und wann auch die andere Person diese Gefühle empfinden kann. Dabei müssen gleichzeitig die gemeinsamen Vorlieben bestehen. Wie genau die Strategien und Mechanismen funktionieren, um die passenden Matches auf der persönlichen „Love Map“ zu finden, verrät Fisher in ihrem 2006 fast fertigen Buch. Wir bleiben hier für Sie dran, versprochen!